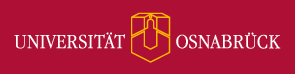Main content
Top content
Veranstaltungsarchiv:
Navigation:
Fachdidaktischer Mentor*innen-Workshop
Hochschulinformationstag (HIT) 2023
Das Denkmal in Bewegung. Eine Mixed-Reality-Ausstellung zur Osnabrücker Geschichtskultur
Tagung "Geschichtsdidaktisch forschen. Theorie und Empirie im Dialog"
Workshop "Geschlecht und Geschichte"
Internationale Jahrestagung des Arbeitskreises "Geschichtsdidaktik theoretisch" 2022
Hochschulinformationstag (HIT) 2022
FUER - "Early Career Researchers" - Kolloquium
Praxisphase GHR 300 - fachdidaktischer Mentor*innen Workshop Geschichte
Am 27. Februar 2024 fand der fachdidaktische Mentor*innen Workshop Geschichte für den Praxisblock GHR 300 statt.
Folgende Themenfelder standen u.a. im Mittelpunkt des Workshops:
- Ziele, Inhalte und Organisation der Praxisphase
- Begleitung der Studierenden durch die Mentor*innen während des Praxisblocks
- fachdidaktische Theorien und Konzepte der Vorbereitungs- und Begleitseminare
- Weiterentwicklung der fachdidaktischen Kompetenzen der Studierenden hinsichtlich der Planung, Durchführung und Reflexion von Geschichtsunterricht und Unterstützung des Professionalisierungsprozesses im Lehramt
- Kriterien für die fachspezifische Unterrichtsbeobachtung und die Unterrichtsnachbesprechung
- Klärung von Fragen zur Durchführung des Praxisblocks
Die Veranstaltung wurde geleitet von Dr.in Hannelore Oberpenning-Kröger, Elena Lehmann und Matthias Bennet.
Hochschulinformationstag 2023
Am 23. November 2023 fand der Hochschulinformationstag (HIT) der Universität und Hochschule Osnabrück statt, an dem auch das Historische Seminar inklusive der Professur für die Didaktik der Geschichte mit vielen verschiedenen Angeboten beteiligt war. Einen von Jessica Wehner und Annika Heyen verfassten Bericht zum HIT 2023 finden Sie hier.
Das Denkmal in Bewegung. Eine Mixed-Reality-Ausstellung zur Osnabrücker Geschichtskultur
Vom 13. bis zum 24. November 2023 fand die Ausstellung "Das Denkmal in Bewegung" in der Bibliothek "Alte Münze" statt. Die Ausstellung ist das Ergebnis der UOS-LehrZeit "Forschen, vermitteln, ausstellen. Virtuelle Lernräume in der Geschichtswissenschaft", in der die Professuren für die Didaktik der Geschichte und für Neueste Geschichte und historische Migrationsforschung des Historischen Seminars mit der Professur für die Didaktik der Informatik kooperiert haben. Die Ausstellung wurde eigenständig von Studierenden der beiden Fächer erarbeitet. Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie hier.
Tagung "Geschichtsdidaktisch forschen. Theorie und Empirie im Dialog."
Vom. 04. bis zum 06. Oktober 2023 fand die gemeinsame Tagung der Arbeitskreise "Geschichtsdidaktik theoretisch" und "Empirische Geschichtsunterrichtsforschung" der KGD in Köln statt Organisiert wurde die Tagung von Prof.in Dr. Lale Yildirim, Prof Dr. Jörg van Norden, Dr. Martin Nitsche und Prof. Dr. Sebastian Barsch. Den von Miriam Grabarits und Freya Kuren verfassten Tagungsbericht finden Sie hier.
History Forum Osnabrück 2023
Am 12. Juni fand das zweite History Forum Osnabrück statt. In diesem Jahr diskutierten Mirjam Adam, M.Ed., PD Dr.in Jessica Kreutz, Imke Selle, M.Ed. und Prof.in Dr. Lale Yildirirm zum Thema "Digital Public History - Chance zur kritischen Partizipation an Geschichtskultur in der pluralen Gesellschaft?". Ein Bericht erscheint bald auf dieser Website.
Workshop "Geschlecht und Geschichte"
Am 30.05.2023 fand der Workshop "Geschlecht und Geschichte" zum reflektierten Umgang mit Geschlecht als historisch gewachsene Kategorie statt. Er wurde durchgeführt von David Gasparjan, M.Ed. (FU Berlin). Einen kleinen Einblick erhalten Sie hier.
Internationale Jahrestagung des Arbeitskreises "Geschichtsdidaktik theoretisch" 2022
Vom 28. bis zum 30. September 2023 fand an der Universität Luxemburg die Tagung des Arbeitskreises "Geschichtsdidaktik theoretisch" (Jörg van Norden, Lale Yildirim) zum Thema "Geschichtsbewusstsein, Geschichtsbilder, Zukunft" statt. Den von unseren Mitarbeiterinnen Patricia Husemann und Imke Sofie Selle gemeinsam mit Judit Ramb (Universität Bielefeld) verfassten Tagungsbericht finden Sie hier.

Hochschulinformationstag (HIT) 2022
Am 17. November 2022 fand der diesjährige Hochschulinformationstag (HIT) der Universität und Hochschule Osnabrück statt, an dem auch das Historische Seminar inklusive der Abteilung Didaktik der Geschichte mit vielen verschiedenen Angeboten vertreten war. Jede Abteilung hatte einen eigenen Stand, an dem die Schüler*innen sich informieren konnten. Die Schüler*innen konnten beim History-Quiz ihr Wissen zu regionalen Fragen und Kuriosem aus der Geschichte unter Beweis stellen und beim Interview Fragen an Studierende aus verschiedenen Fachsemestern richten. Außerdem konnten sie sich eine Vorführung der geophysikalischen Vermessungsmethoden zum Erfassen von Bodenstrukturen bzw. zum Durchführen von Bodenscans ansehen.

History Forum Osnabrück 2022
Die Auftaktveranstaltung des jährlich geplanten History Forum Osnabrück am 13.06.2022 mit dem Titel ,,Geschichte(n) in der pluralen Gesellschaft – Erinnern und Konflikt‘‘ wurde von der Universität Osnabrück ausgerichtet und von der Professur für die Didaktik der Geschichte (GEDIOS) organisiert. Das History Forum Osnabrück lädt Interessierte aus Wissenschaft und Gesellschaft zum kritischen Austausch über aktuelle historisch-politische Themen der Geschichts- und Erinnerungskultur ein und will neben einem fachlichen Austausch besonders zur Öffnung der Universität beitragen.
Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung hatten vier Historikerinnen und/ oder Geschichtsdidakterinnen die Möglichkeit, ihre Perspektiven untereinander, aber auch mit den Zuschauer*innen zu diskutieren. Hierfür wurde das Gespräch im Anschluss an die Podiumsdiskussion für das Plenum geöffnet.
Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Podiumsteilnehmerinnen durch Lale Yildirim (Osnabrück), Kai-Uwe Kühnberger (Osnabrück), der in Vertretung für die Universitätspräsidentin Susanne Menzel-Riedl (Osnabrück) anwesend war und Nicole Diersen (Osnabrück) als Vertretung für Christiane Kunst (Osnabrück), bot Lale Yildirim einen thematischen Einstieg, der an die Themen des diesjährigen History Forums anknüpfte. Hierbei benannte sie vor allem Chancen und Herausforderungen der Didaktik der Geschichte in Bezug auf Erinnern und Konflikt in der diversen Gesellschaft. Anschließend übergab sie das Wort an Imke Sofie Selle (Osnabrück), die als studentische Mitarbeiterin die Moderation übernahm.
Auf dem Podium der Auftaktveranstaltung diskutierten Elke Gryglewski (Bergen-Belsen), Juliane Brauer (Wuppertal), Cornelia Chmiel (Berlin) und Jessica Wehner (Osnabrück). Elke Gryglewski ist Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Expertin für das Auswärtige Amt zur Frage der Gestaltung einer Gedenkstätte zur Geschichte der Colonia Dignidad in der Villa Baviera, Chile. Juliane Brauer ist seit Oktober 2021 Professorin für Geschichte und ihre Didaktik an der Bergischen Universität Wuppertal und forscht zu den Schwerpunkten Emotionen und Historisches Lernen und Musik im Geschichtsunterricht sowie zu Heimatgefühlen im 19./20. Jahrhundert und den digitalen Geschichtskulturen. Cornelia Chmiel ist Doktorandin und Mitarbeiterin am Arbeitsbereich der Didaktik der Geschichte an der Freien Universität Berlin. Sie hat sich in ihrer Masterarbeit mit dem Titel ,,Wir sind keine antifaschistische Waschmaschine” im Rahmen des Projekts ,,Geschichten in Bewegung’’ mit dem Umgang pädagogischer Mitarbeiter*innen in Bezug auf Diversität beschäftigt, woran auch ihr Dissertationsprojekt unter stärkerer Berücksichtigung von Agency anknüpft. Jessica Wehner ist Doktorandin im Projekt ,,Norms and Marginality: Practices of Recognition as a Displaced Person” im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) geförderten DACH-Projekt ,,Normen, Flucht, Agency: Aushandlung eines Migrationsregimes”. Sie ist Mitarbeiterin an der Professur für Neueste Geschichte und Historische Migrationsforschung sowie Mitglied am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück.
Imke Sofie Selle eröffnete die Fragerunde, indem sie die Podiumsteilnehmerinnen nach ihren Erfahrungen mit pluralen Geschichten befragte. Im Zuge dessen ging es vor allem um die Frage, wie sich Erinnern und Konflikt in einer pluralen Gesellschaft zeigen und welche Bedeutung diesen Phänomenen zugerechnet werden kann. Außerdem ging es um die Verbindung zwischen Konflikten und Emotionen, aber auch um die alltägliche Konfrontation mit pluralen, konflikthaften Geschichten, beispielsweise im Hinblick auf Gedenkstätten wie Bergen-Belsen. In dieser ersten Diskussion sind wichtige Eigenschaften der Geschichte und ihrer bildenden Funktionen benannt worden. Cornelia Chmiel sieht den „Konflikt als Motor der Gesellschaft“, während Elke Gryglewski ergänzt, Konflikte dürften nicht gewertet und gleichgesetzt, sondern es müsse Raum für jede Geschichte, jeden Konflikt und jede Dimension von Identität geschaffen werden. Juliane Brauer setzte sich für eine zunehmende Bereitschaft, den digitalen Raum in die Geschichtswissenschaft einzubeziehen, ein. Dieser dürfe aber nicht glorifiziert, sondern müsse mit all seinen Chancen und Herausforderungen differenziert betrachtet werden, so Brauer.
Die Podiumsteilnehmerinnen waren sich zudem einig, dass die Schüler*innen in den heterogenen Klassen zu Expert*innen gemacht werden sollen. Hierfür solle vom Subjekt der Schüler*innen gedacht werden, um allen Lernenden Raum zu geben, eigene Fragen zu entwickeln, die sich aus persönlichen Erfahrungen ergeben. Die Schüler*innen sollen dabei lernen, sich kritisch mit Geschichte auseinanderzusetzen und ihr eigenes Verständnis zu entwickeln. Dafür solle die Lehrkraft den Schüler*innen das Handwerkszeug der Geschichtswissenschaft beibringen, um allen individuellen Erfahrungen Wertschätzung entgegenzubringen und den Geschichtsunterricht inklusiv zu gestalten. In Bezug auf die Schule diskutierten die Teilnehmerinnen auch über grundlegende Chancen und Schwierigkeiten, die ,,Schule als Masseninstitution’’ (Cornelia Chmiel) mit sich bringe. Die subjektorientierte Gestaltung des Unterrichts trage dazu bei, Perspektiven wahrzunehmen, denen momentan zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde. Durch die Größe der Klassen und die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte gestalte sich die Umsetzung jedoch schwierig. Ebenso stelle die Unsicherheit im Umgang mit aktuellen Kriegs- und Konfliktsituationen vieler Lehrkräfte ein großes Problem für den Unterricht dar, weil dieser Lebensweltbezug als Chance genutzt werden könnte, Themen zugänglich und diskutierbar zu machen (Juliane Brauer) und Schüler*innen für ,,alternativfaktische Erzählungen zu sensibilisieren’’ (Jessica Wehner). In diesem Zusammenhang betonte Elke Gryglewski, die Lehrer*innenbildung stehe durch die prekäre Lage in den Schulen vieler Bundesländer vor großen Herausforderungen, da viele Geschichtslehrer*innen in ihrem Fach nicht gut genug ausgebildet seien. Während der Diskussion wurde deutlich, dass auch der fehlende Raum für Reflexion der Lehrkräfte nach dem Studium sowie das Benotungssystem als maßgebliche Probleme der Lehrer*innenbildung angesehen werden. Im Zuge dessen stellte sich die Frage, inwiefern festgelegte Rahmenthemen in den Kerncurricula und hieran anknüpfende Kompetenzen wirklich Raum für diverse - abseits des weiß-deutschen erinnerungskulturellen Konstrukts - Fragen lassen, die für Partizipation und Sichtbarkeit wesentlich seien. Cornelia Chmiel stellte fest, dass der Vermittlungskanon des Geschichtsunterrichts bis jetzt überwogen hat und die Geschichtslehrer*innen die Fragen der Schüler*innen stärker in den Fokus setzen sollten. Zudem solle nicht versucht werden, jedes Thema als besonders relevant zu markieren, damit die Schüler*innen anhand der epochaltypischen Schlüsselprobleme für ein Thema begeistert werden könnten.
Diese gleichberechtigte Teilhabe an Geschichte(n) könne durch den digitalen Raum gefördert werden. Während der Podiumsdiskussion sowie im Gespräch mit den Zuschauer*innen wurde Digitalität mitsamt ihren Chancen und Barrieren vielschichtig erörtert. Zwar stehe der digitale Wandel für veränderte Handlungs- und Verhandlungsspielräume von Akteur*innen und trage zu einer unkomplizierteren Vernetzung von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen bei, hierbei dürfe aber nicht unbeachtet bleiben, dass Machtstrukturen auch im digitalen Raum vorhanden sind, diesen prägen und exkludierend wirken. Auch die technischen und finanziellen Voraussetzungen, die für das Partizipieren-Können erfüllt sein müssen, grenzen bestimmte Personen(gruppen) automatisch aus Aushandlungsprozessen aus. Zudem müssten problematische Narrationen in den sozialen Medien erkannt werden, was die Relevanz der Förderung digitaler Kompetenzen bestärke. Das selbstständige Stellen von Fragen fördere eine kritische Grundhaltung gegenüber Geschichtsbildern und könne somit den De- und Rekonstruktionsprozessen solcher Bilder dienen. Da der digitale Raum heute als wesentlicher Bestandteil gesellschaftlicher Kommunikations- und Aushandlungsprozesse verstanden werden müsse, seien die mit ihm verbundenen Chancen nicht zu unterschätzen. Durch das Agieren vieler unterschiedlicher Personen(gruppen) sei es möglich, globalere Perspektiven einzunehmen und in der Gesellschaft unterrepräsentierte Akteur*innen wahrzunehmen. Dieser Austausch biete Angebote zur Partizipation und führe zu steigender Sichtbarkeit, was ein aktives Mitgestalten der Geschichts- und Erinnerungskultur ermögliche.
In der weiteren Diskussion ging es neben der Gestalt der pluralen Gesellschaft und ihren Mechanismen auch um ihre Chancen in der Europäischen Union (EU). Als Ziel wurde eine steigende Sichtbarkeit von pluralen Geschichten in den Gesellschaften der EU benannt, was dazu führen würde, dass verschiedene Perspektiven nicht erkämpft werden müssten und ein komplexer Aushandlungsprozess zwischen den verschiedenen Akteur*innen der Länder entstehen könne (Cornelia Chmiel). Außerdem solle sich vom EU-Konzept losgelöst werden, um ausgehend vom Menschen zu denken und Orte der Geschichte zu entemotionalisieren und so Sichtbarkeit und Partizipation, die sich auch im digitalen Raum zeigen, zu ermöglichen (Juliane Brauer). ELKE GRYGLEWSKI bezog zudem auch die Täterkomplexe mit ein und führte den Gedanken des neuen Konzeptes aus. Ein Konzept solle frei von den Herkünften entwickelt werden und so möglichst umfassend wirken. Jessica Wehner beleuchtete die Sicht der Forschung, die durch die plurale Gesellschaft und ihre vielen unterschiedlichen Perspektiven angeregt werde. Hierbei sei auch ein Bewusstsein für die Standpunkte, Vorstellungen und Interessen von Forschenden von besonderer Bedeutung, da sich vom Konzept der vollkommen wertfreien Forschung losgelöst werden solle.
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion war ein Ausblick in die Zukunft der Didaktik der Geschichte geplant. Juliane Brauer appellierte für den Ausbau des digitalen Raumes und die Förderung digitaler Kompetenzen, da dieser vielfältige Möglichkeiten zur Partizipation biete. Elke Gryglewski knüpfte an diesen Gedanken an und verwies auf die Notwendigkeit des Austauschs mit Menschen, denen gesellschaftliche Präsenz bislang verwehrt blieb. Außerdem sollten Projekte der universitären Forschung in die Praxis und somit in die Lebenswelt der Gesellschaften integriert werden. Auf die Perspektiven der Universitäten ging auch Jessica Wehner ein, die für mehr Pluralität plädierte und auf intersektionale Zugänge verwies. Neben den Potentialen des digitalen Raumes solle auch allgemeinen Potentialen der Geschichte mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Hierfür seien laut Cornelia Chmiel Abgrenzungen zwischen shared und divided memories sinnvoll.
Das diesjährige History Forum bot allen Podiumsteilnehmerinnen und Zuschauer*innen Raum, aktuelle gesellschaftliche Themen im Kontext von Erinnern und Konflikt zu diskutieren. Schwerpunkte bildeten hierbei vor allem der Umgang mit Digitalität und die hiermit verbundenen Chancen und Schwierigkeiten sowie allgemeine gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die immer mit besonderem Blick auf strukturell benachteiligte oder diskriminierte Personengruppen erörtert wurden. Ziel dieser Diskussionen war es, für konflikthafte Erinnerungen zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für die sich hieraus ergebenden Herausforderungen, aber auch Zukunftsperspektiven der Geschichte zu schaffen.
Die Veranstaltungsreihe wird im Jahr 2023 fortgeführt.
Julia Arnold, Patricia Husemann und Marek Alferink
FUER - "Early Career Researchers" - Kolloquium
Am 31. März und 01. April 2022 fand an der Universität Osnabrück das FUER - "Early Career Researchers" Kolloquium statt, das von der Professur für Didaktik der Geschichte organisiert wurde. Dort wurden die Forschungsprojekte von verschiedenen Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen Statusgruppen vorgestellt und diskutiert. Den von Jessica Wehner und Imke Sofie Selle verfassten Tagungsbericht können Sie hier lesen.